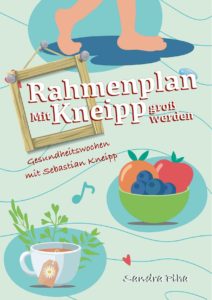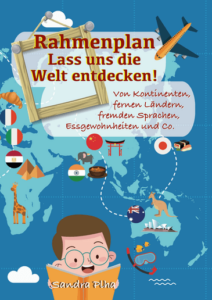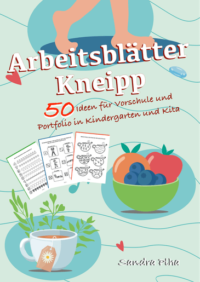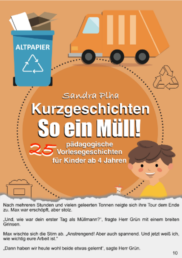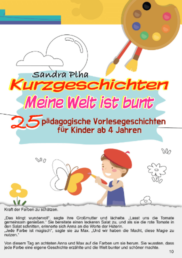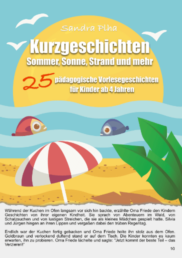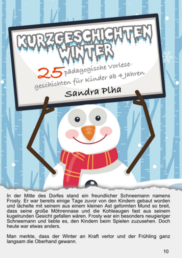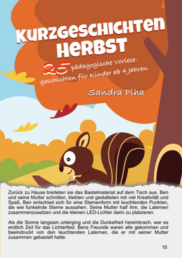Eingewöhnung in der Kita – warum der Anfang heute anders ist als früher
Wenn im Sommer die Türen der Kita aufgehen und die neuen Kinder hereinkommen, beginnt für uns Erzieherinnen eine ganz besondere Zeit: die Eingewöhnung. Kaum ein anderer Abschnitt im Jahr ist so spannend, aber auch so herausfordernd. Viele von uns denken dabei: „Früher war das doch irgendwie einfacher.“ Tatsächlich hat sich die Eingewöhnung in den letzten Jahren spürbar verändert – und dafür gibt es gute Gründe.
Früher: unkomplizierter Start – oder nur scheinbar?
Bis vor rund 20 Jahren kamen die meisten Kinder mit drei Jahren in den Kindergarten. Sie konnten sich sprachlich schon gut ausdrücken, waren in ihrer Entwicklung gefestigter und kannten oft schon kurze Trennungen von den Eltern. Der Start wirkte deshalb unkomplizierter.
Eine Eingewöhnung bestand häufig aus ein paar Tagen Spielen, während Mama oder Papa noch im Raum blieben. Heute wissen wir: Nicht alle Kinder fühlten sich damals wirklich sicher – es fiel nur weniger auf, weil Bindungssensibilität noch kein großes Thema war.
Heute: Jüngere Kinder brauchen mehr Halt
Mit dem Rechtsanspruch auf Betreuung ab dem ersten Geburtstag hat sich alles verändert. Immer mehr Kinder unter drei Jahren kommen in unsere Gruppen. Und wir alle erleben es: Einjährige brauchen etwas anderes als Dreijährige. Sie suchen mehr Nähe, sie testen vorsichtig, ob sie uns vertrauen können, und sie brauchen Zeit.
Deshalb dauern Eingewöhnungen heute länger – nicht, weil wir zu „kompliziert“ geworden sind, sondern weil wir achtsamer mit den Bedürfnissen der Kleinsten umgehen.
Statistiken zeigen deutlich: Die U3-Betreuungsquote ist in den letzten zehn Jahren stark gestiegen, bei den 2- bis unter 3-Jährigen liegt sie mittlerweile bei über 66 Prozent. Mehr Kinder, die jünger sind – das verändert die Arbeit in jeder Kita.
Von Bauchgefühl zu festen Konzepten
Früher war die Eingewöhnung oft eine intuitive Aufgabe: Wir haben geschaut, ob das Kind spielt, und entschieden nach Gefühl. Heute stützen wir uns auf klare Konzepte.
Das bekannteste ist das Berliner Eingewöhnungsmodell, das in Phasen abläuft und auf der Bindungstheorie von Bowlby und Ainsworth basiert. Es sagt ganz klar: Das Kind gibt das Tempo vor. Meist rechnen wir mit zwei bis vier Wochen, manchmal mit mehr.
Daneben gibt es das Münchener Eingewöhnungsmodell, das ebenfalls stark auf Beziehung setzt, aber andere Schwerpunkte legt – etwa die enge Rolle des Teams. Wichtig ist: Diese Modelle sind Leitplanken, keine starren Regeln. Unsere pädagogische Feinfühligkeit bleibt das Entscheidende.
Was die Forschung sagt – Stress und Sicherheit
Dass die Eingewöhnung wichtig ist, zeigen auch wissenschaftliche Studien. Forschungen (u. a. Ahnert et al.) belegen, dass Kinder in der Eingewöhnungszeit oft einen erhöhten Cortisolspiegel haben – ein Zeichen für Stress.
Doch: Wenn die Eingewöhnung sanft und beziehungsorientiert verläuft, sinkt der Stress deutlich schneller ab. Das gibt uns Rückenwind: Unsere Geduld und unser Blick für das einzelne Kind machen einen messbaren Unterschied.
Mehr Aufwand – aber auch mehr Qualität
Viele Kolleginnen erleben die Eingewöhnung als kräftezehrend. Mehrere Wochen enge Elternbegleitung, tägliche Absprachen, Rückmeldungen. Doch genau das zahlt sich aus: Kinder bauen Vertrauen auf, Eltern fühlen sich ernst genommen, und wir legen den Grundstein für eine stabile Zusammenarbeit.
Studien zeigen: Eine gute Eingewöhnung beeinflusst nicht nur die ersten Wochen, sondern die gesamte Kita-Zeit positiv.
Rahmenbedingungen: Qualität braucht Zeit und Personal
Wir alle wissen: Eingewöhnung gelingt nur, wenn wir dafür Zeitfenster, Teamstabilität und gute Personalschlüssel haben. Fachleute empfehlen für U3 ein Verhältnis von 1:3, für Ü3 von 1:7,5.
In vielen Einrichtungen sieht die Realität leider anders aus. Deshalb ist es so wichtig, dass Politik und Träger uns unterstützen. Mit dem KiTa-Qualitätsgesetz will der Bund seit 2023 genau hier ansetzen: bessere Personalschlüssel, mehr Fachkräfte, gezielte Sprachförderung.
Für uns heißt das: Eingewöhnungen können dann so gestaltet werden, wie Kinder sie brauchen – nicht wie der Dienstplan es zulässt.
Fazit: Mehr Herz, mehr Fachlichkeit
Die Eingewöhnung ist heute nicht komplizierter geworden, sondern bewusster. Wir achten stärker auf Bindung, wir nehmen Stresssignale ernst, wir begleiten Eltern eng. Ja, es kostet Kraft. Aber es lohnt sich – weil ein gelungener Anfang über die gesamte Kita-Zeit entscheidet.
Und vielleicht ist genau das die gute Nachricht: Wir sind als Erzieherinnen heute nicht nur „Betreuerinnen“, sondern Beziehungsbegleiterinnen. Wir schaffen Sicherheit, wir geben Halt, wir öffnen Türen – Schritt für Schritt.